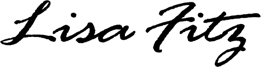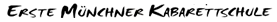(Erschienen am 11.08.2021 im Feuilleton der Passauer Neuen Presse)
Die Kunst, den eigenen Weg zu gehen
Im September wird Lisa Fitz 70 – Im PNP-Interview spricht sie übers Älterwerden, Freikämpfen, Männer und Strauß’ Knie
Vor einem halben Jahrhundert stand Lisa Fitz als 20-Jährige bereits auf der Bühne. Am 15. September wird Bayerns berühmteste Kabarettistin 70 Jahre alt. Die Passauer Neue Presse hat sie zu Hause auf ihrem Anwesen im Rottal zum Interview besucht.
Frau Fitz, zu Ihrem 60. Geburtstag war die Rede von der „unaussprechlichen Zahl“ … Lisa Fitz: (lacht) Ja, genau! Das könnte man jetzt eigentlich wieder sagen.
Haben Sie schon gelernt, „siebzig“ auszusprechen? Fitz: Nicht wirklich, ich hab keinen Bezug dazu, aber das war mit 60 auch schon so. Mit 40 hab ich gedacht, Mensch, jetzt werd ich ganz alt, mit der Vier vorn dran wird alles ganz schrecklich. Der 50. war super, das war eine Riesenfeier in München im Schlachthof. Und den 60. haben wir in Passau auf dem Schiff „Sissi“ gefeiert. Der Geburtstag an sich war wunderschön, aber bis zwei Tage vorher war mir nicht klar, was die Sechs vorn dran bedeutet. Man sagt’s als Frau nicht gern jedem, aber in dem Fall habe ich die Flucht nach vorn angetreten, weil, wenn ich ehrlich bin, bin ich auch ein bissl stolz auf die Lebensleistung.
Die Alternative zum Älterwerden wäre ja auch nicht gut. Fitz: Man kriegt schon irgendwann die Quittung für die Dinge, wo man gesündigt hat. Ich hab ja Gott sei Dank alle Süden früh erledigt, ausgiebigst, mit Trinkgelagen und frivolen Ereignissen. Dann kommt man wie die Rocksänger irgendwann drauf: Wenn du nicht den Lebensstil änderst, dann heißt es „Live hard, die young“. Man kann das schon gut steuern, indem man auf sich aufpasst.
Sie betreiben ja Sport seit langer Zeit. Fitz: Also jetzt mehr Yoga (lacht) und Nordic Walking, weil – das ist das Lustige dran – ich mir durch drei Halbmarathons meine Knie zerlaufen hab. Aber mit 30 habe ich Herzprobleme gehabt, die verschwunden waren, als ich zum Rauchen aufgehört hab. Ich hab erkannt: Der Körper ist mein Freund, und kein Feind, dem man sagt, dich mach ich fertig!
Es heißt oft, dass Frauen ab 40 oft keine guten Rollen mehr angeboten bekommen. Das ist bei Ihnen als Kabarettistin anders. Fitz: Ich hab das im neuen Programm drin. Ich bin ja mit 20 Jahren als Moderatorin der „Bayerischen Hitparade“ im BR über Nacht bekannt geworden. Das hatte bis dato die Ruth Kappelsberger moderiert, und die war – das muss man so sagen – fürs Fernsehen damals zu alt geworden. Die Männer haben noch von der Intensivstation moderiert, aber eine Frau war mit Mitte 40 zu alt. Im Kabarett ist mein Großvater Hans Fitz mein Vorbild, ich kann spielen, so lange Leute kommen und bis ich umfalle.
Haben Sie das vor? Fitz: Ja! Wenn die Leute kommen und ich Lust habe und gesund bin, dann bleibe ich, bis ich bröckle.
Die frühe Karriere beim BR haben Sie aufgegeben. In Ihrer Autobiografie „Der lange Weg zum Ungehorsam“ heißt es darüber: „Lieber fünf Leute in der Kleinkunstbühne als weiter diesen Scheiß“. Was war so fürchterlich an der „Bayerischen Hitparade? Fitz: Das Fürchterlichste war, dass wir aufgewachsen sind mit den Beatles und den Stones, wir haben mit dieser volkstümlichen Musik und den Leuten überhaupt nix anfangen können.
Warum haben Sie dort dann überhaupt angefangen? Fitz: Mein Vater war Produzent, so was wie Dieter Bohlen in kleiner. Ich war auf der Schauspielschule und habe mit meiner Freundin Lieder aufgenommen. In der Zeit hat der BR meinen Vater nach Gruppen gefragt – und ob ich moderieren kann. Und das hat eingeschlagen.
Was sagt ein Vater, wenn man das hinschmeißt? Fitz: Der hat mich überhaupt nicht verstanden und hat gesagt: Du bist undankbar, du sitzt schon aufm hohen Ross. Aber ich hab gesagt: Ich halte das nicht aus. Für mich war das – man verzeihe das Wort – eine Deppenhölle. Und der Knackpunkt war, als der Chef der Bierzelt-Musi auf dem Oktoberfest mit 5000 Betrunkenen im Zelt ins Mikro gedröhnt hat: Wir haben heute einen ganz berühmten Gast, unsere Lisa Fitz, jetzt komm rauf und tu uns dirigieren! Ich hätte im Boden versinken können. Heute könnte ich das, aber damals war ich nicht cool genug. Das war ganz furchtbar, und ich hab mir gedacht: Ich muss da raus, es gibt kein richtiges Leben im falschen.
Wann haben Sie sich wieder versöhnt? Fitz: Das war ein Bruch, weil ich mich auch aus seinem Management gelöst habe und von ihm als Produzenten – und er hatte gedacht, das sei eine künstlerische Verbindung, die ein Leben lang halten würde. Er war sehr verletzt, und später, als ich ab 1985 als Kabarettistin Fuß gefasst habe und er sich meine Vorstellungen angeschaut hat, da hatte er Schwierigkeiten mit diesem Lied …
Ihr Song „Mein Mann ist Perser“ über ihren ersten Ehemann Ali Khan. Fitz: Ich erinnere mich, wie live im Bayerischen Fernsehen ein völlig verstörtes, ratloses Publikum diesem Lied gelauscht hat, und mein Vater hat gesagt: Müsst ihr immer im Dreck wühlen?! Ich wollte damals aus diesem Bierdimpfl-Sumpf raus und hab gebetet zum lieben Gott: Bitte schick mir jemanden, der mir eine Form gibt! Da erschien Herr Ali Khan auf der Bildfläche und hat mich – im Gegensatz zu meinem Vater – immer ermuntert, die scharfen, bösen Spitzen drinzulassen. Die „Bild“ hat dann geschrieben: „Lisa Fitz: Hochzeit mit persischem Rockschlagzeuger.“ Er war ja eigentlich ein Bayer aus Pasing, Mutter aus Südtirol, Vater aus Persien, wie man damals gesagt hat.
Was geschah dann? Fitz: Dann habe ich Briefe bekommen: „Fitz, jag den Kameltreiber zum Teufel!“ und „Ein Perser, der liegt bei uns am Boden!“, und das Schlimmste, als ich schwanger war, hat einer geschrieben: „Dir soll die Gebärmutter aus dem Leib faulen.“ Für mich war das ein Schock, ich hab nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich habe diese ganzen Vorurteile gesammelt und das Lied draus gemacht: „Mein Mann ist Perser, ein ganz perverser, Teppichhändler, Frauenvernascher, Fixer, Wichser, Dealer, Hascher, chauvinistisch, drogensüchtig, schreiben kann er auch nicht richtig, arbeitsscheu und schwul, und schlägt mich täglich mit dem Stuhl“. Ali ist erschrocken – aber er fand es so gut, dass er gesagt hat, das bringen wir raus! Den Leuten ist die Luft weggeblieben, aber es wurde ein Kult-Hit. Künstlerisch war unsere Beziehung sehr fruchtbar, Ali hat mich auf den Kabarettweg gebracht.
Über eine andere Erfahrung mit Männern schreiben Sie: „Er dampfte wie ein wilder Stier“ – Franz Josef Strauß hat Sie mit Mitte 20 einmal zum Essen eingeladen in die Osteria Italiana. Woher hatte der Ministerpräsident Ihre Telefonnummer? Fitz: Ganz einfach: Mein Vater war der erste Strauß-Parodist am Nockherberg. Er hatte eine lose Bekanntschaft mit Strauß, war eingefleischter CSU-Wähler und Fan vom Strauß. Ich habe eine Langspielplpatte von mir für ihn unterschreiben, mein Vater war stolz, dass er sie überreichen konnte – und dann hat der Strauß gesagt: Was meinen S’, Herr Fitz, kann ich Ihre Tochter vielleicht mal zum Essen einladen? Und der Vater hat gesagt, das müssen Sie sie selber fragen, und hat ihm die Telefonnummer gegeben. Dann wach ich am Sonntag in der Früh auf, war der Herr Strauß am Telefon und hat mich zum Essen eingeladen, ich hab gedacht, ich hör nicht recht.
Wie verlief der Abend? Fitz: Ich bin da hin, es war noch ein ehemaliger Faschingsprinz dabei und seine Freundin, ein seltsames Vierergespann. Es war sehr verkrampft, der Faschingsprinz hat schlechte Witze gemacht und der Strauß hat nur die Nudeln in sich reingeschaufelt. Auf einmal spür ich unterm Tisch ein Knie. Ich hab gedacht, wahrscheinlich hat mich wer mit dem Stuhlbein verwechselt, aber dann schau ich runter und sehe, es ist das Knie vom Strauß. Es war klar, das ist die Anmache eines bayerischen Ministerpräsidenten. Sie haben mich noch eingeladen in eine Wohnung, und man hat die deutliche Bereitschaft gemerkt, dass das noch weitergehen könnte. Ich hab mich dann geflüchtet und gesagt, ich muss noch zum Bayerischen Rundfunk zu einer Feier. Ich hab Blut und Wasser geschwitzt, wie ich aus der Situation rauskomme. Ich war ein Mädel und das war der Ministerpräsident – wenn ich’s auf Bairisch sagen müsste: Die scheißen sich nix!
Seit 2002 sind Sie ein Paar mit dem Maler und Illustrator Peter Knirsch. Fitz: Ja, für mich die längste Beziehung überhaupt. Wir haben uns kennengelernt in Faak am See in Österreich bei einem Harley-Treffen. Er war der Verkaufsleiter von Harley Davidson, wir haben uns immer wieder getroffen an dem Tag und uns am nächsten Abend verschämt gestanden, dass jeder am anderen eigentlich mehr Interesse hätte. Später haben wir drei Wochen Probewohnen gemacht, ob das auch gut geht, und seitdem sind wir zusammen. Peter ist wirklich ein sehr beziehungsfähiger Mann, der mir sehr gut tut.
Reden wir über Meinungsfreiheit: Seit Ihrem Lied „Ich sehe was, was du nicht siehst“ über „Schattenstaat, Schurkenbank und Gierkonzern“, in dem Sie Namen von jüdischen und nichtjüdischen Familien nennen, wurden Sie hart kritisiert und auch in eine antisemitische Ecke gestellt. Sie haben ein Grußwort anlässlich einer Preisverleihung für Ken Jebsen verfasst, der heute vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wie stehen Sie heute dazu? Fitz: Erst einmal muss ich der PNP und Ihnen ein Kompliment machen: Sie waren die Einzigen, die mich angerufen haben, und ich hatte die Chance, eine Antwort zu geben. Die anderen haben mich einfach abgeurteilt. Das andere ist, dass ich einigen Leuten Interviews gegeben habe, bei denen damals für mich nicht erkennbar war, dass die in eine bestimmte Richtung marschieren. Inzwischen habe ich ein paar Kontakte beendet, weil es in eine Richtung ging, die ich nicht will.
Sie waren die erste Frau mit eigenen politischen Texten im Kabarett – warum gibt es heute immer noch so wenige davon? Fitz: Es war über Jahrhunderte nicht üblich, dass Frauen öffentlich über politische Ereignisse nachdenken, spotten und etwas kritisieren. Bis in die 70er, 80er hatte der Mann das Sagen. Das hat sich ganz langsam erst entwickelt. Ich bin da über die humorvoll-netten Lieder wie „I bin bled“ hineingewachsen, und dieser Biss kam erst durch die Ehe mit dem Ali, der durch seine Herkunft eine völlig andere Sicht auf die Gesellschaft hatte als ein CSU-Bayer. Beim ersten Programm „Heilige Hur“ hatte ich vielleicht sogar noch einen Frauenbonus, im zweiten Programm „Geld Macht Geil“ und in den folgenden Programmen haben sich Männer langsam zu fürchten angefangen. Und in „Heil“ über eine Frau, die eine Krise hat, in Therapie geht und ihr Heil in der deutschen Ordnung findet, da war ich vielen Leuten dann unheimlich, weil ich so eine Bühnenkraft, so eine Präsenz, so eine Aggression und auch Sexualität nach vorne entwickelt hatte. Das war auch für die Fernsehsender zu viel.
Apropos Aggression: Ihr Sohn Nepo Fitz ist sehr erfolgreicher Kabarettist, über ihn haben Sie uns einmal erzählt, wie er Sie als Teenager im Wohnzimmer anschreit: „Ich kann nicht singen!“ Und Sie schreien zurück: „Doch, du singst jetzt, und zwar laut!“ Muss man Hemmungen manchmal mit Gewalt durchbrechen? Fitz: Ich finde schon. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das Schlimmste, was Künstler – aber auch andere Menschen – haben, ist vergeudetes Talent und Hemmungen. Wenn man sich selber im Weg steht. Ich musste am Münchner Volkstheater in „Glaube und Heimat“ eine Mutter spielen, deren vierjähriger Sohn im Mühlbach ertrunken ist. Sie rennt runter, holt ihn raus und lässt nur einen Urschrei los. Ich habe jeden Tag in der Probe eine Ausrede erfunden, warum ich das heute nicht mache. Als ich zum ersten Mal geschrien habe, fand ich das ganz furchtbar und lächerlich. Aber dann war die Membran durchstoßen, und dann wird’s was.
Gibt’s den Geheimtipp für Menschen mit Hemmungen? Fitz: Ja. Es erst mal alleine machen, sich aufnehmen am Handy, daheim laut sein, wenn die Nachbarn nicht da sind, oder in den Wald gehen und das machen, vor dem man Angst hat. Man muss sich die Peinlichkeit antun, sich das anzuhören. Und bloß nicht aufhören und sagen, ich kann das nicht! Ich habe ungefähr 4500 Soloabende gemacht, da lernt man’s dann.
Waren Sie vor der Bühnenkarriere schon so selbstbewusst? Fitz: Ich war überhaupt nicht selbstbewusst. Das ist gewachsen durch die Bühne. Auch wenn man’s nicht glaubt: Es streiten sich heute immer noch in mir die Höflichkeit und der Wille, auch mal jemanden zusammenzufalten.
Sie spielen jetzt ihr Jubiläumsprogramm – wie geht es dann weiter? Fitz: Die Veranstaltungsbranche ist im Prinzip tot. Die Corona-Maßnahmen sind so widersprüchlich, ich finde es unsäglich, was da politisch passiert, das sage ich gern jederzeit laut. Es ist sowas von dilettantisch, wenn man Existenzen und ganze Wirtschaftszweige zerstört. Wenn sich das nicht lohnt, dass man eine Strecke von 400 Kilometern fährt und dann darf der Veranstalter kaum Leute reinlassen, dann würde ich langsam die Richtung wechseln und mich wieder mehr ums Fernsehschauspiel kümmern. Aber nur wegen Corona aufhören, das fände ich feig. Ich lass mir doch vom Virus nicht meine Kunst nehmen!
Das Gespräch führte Raimund Meisenberger
Ressortleiter Feuilleton der Passauer Neuen Presse